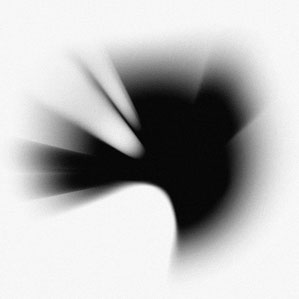
von Mathias Haden, 28.11.2013
Mit experimentellem Apokalypse-Synthiepop bugsieren sich die Amis vorübergehend ins Abseits.
Willkommen in der tristen Welt der sinkenden Rockband Linkin Park. Werfen wir mal einen kurzen Blick zurück: Nach zwei erfolgreichen, im Nu-Metal beheimateten Alben beschloss die Band zunächst, sich in radiofreundlichem Kommerz-Pop zu baden. Wie zu erwarten, verkaufte sich auch LP Nummer 3 ganz ordentlich (immerhin über 12 Millionen Mal bis jetzt). Amüsant wird es erst, wenn man sieht, in welche Richtung es auf dem nächsten Longplayer gehen sollte. Der heißt A Thousand Suns und ist im Prinzip all das, was man von Linkin Park niemals erwartet hätte und vor allem - ich wiederhole mich hier gerne - 'niemals' hören wollte.
Die Platte ist nämlich als Konzeptalbum zu verstehen, auf dem sich komplexe Thematiken um einen an Radioheads Kid A oder Brian Enos Klangwelten erinnernden Sound ranken. Also wirklich nichts, was man mit dem Namen Linkin Park in Verbindung bringen hätte können. Dennoch sollte man den konservativen Fans der Band einen Schritt voraus sein und der Scheibe zumindest eine faire Chance geben. Den Kritikern hat es ja auch ganz gut gefallen, was bei einem Werk, das eher in Richtung Kunst als Musik geht, gar nicht mal so verwunderlich ist.
Diese Entscheidung bereut man allerdings spätestens, nachdem man sich dem Album über die Laufzeit einer knappen Stunde hingegeben hat. Denn experimenteller Sound ist eines, das aber dann so stümperhaft und unfertig wirken zu lassen, wie es hier scheint, ist etwas anderes. Allein sechs der fünfzehn Tracks sind nicht mehr als Skits, zusammengestellt aus einigen Synthie-Sounds, Scratches, Loops und verzerrten Stimmen. Wohl dazu gedacht, die apokalyptische Stimmung des Albums zu transportieren, nerven die meisten davon ordentlich. Einzige Ausnahme ist Opener The Requiem. Egal, wem diese helle Frauenstimme in diesem 'Liedchen' gehört, oder ob da nur Justin Bieber einen Gastauftritt hinlegt, diese funktioniert in Kombination mit den einfachen Elektronik- und Klaviersounds recht gut. Beim Rest, egal ob mit Interview-Ausschnitt von Robert Oppenheimer (The Radiance), dem Ausschnitt einer Martin Luther King-Rede (Wisdom, Justice And Love) oder manchmal auch weniger, fragt man sich eigentlich nur, warum diese Sekunden unbedingt auf das Album mussten. Besonders wenn man sich ohnehin schon an einen grotesken The Wall-Abklatsch erinnert fühlt, um dann mit Empty Spaces (seeehr essentielle 18 Sekunden) sogar einen Titelnamen zu lesen, der bei Pink Floyds Konzeptalbum auch als Instrumental vorhanden ist.
Bei einem Teil der Musik geht es einem ähnlich. Der Verzicht auf harte Gitarren, wütenden Gesang und den charakteristischen Shinoda-Rap ist befremdlich, hätte aber zu großartigen Sounds führen können. Hätte, er tut es aber allzu selten. Bei Burning In The Skies, in dem Shinoda wieder einmal beweist, dass er durchaus singen kann, gelingt es dank starkem Beat, eingängigem Gitarren-Part und Klavier-Begleitung zumindest ansatzweise. So ist es auch bei der poppigen Ballade Iridescent, eigentlich ähnlich aufgebaut, dank Bennington als Lead-Sänger aber doch besser. Und einmal kommt sogar kurz die alte, wütende Ader der Band zum Vorschein. In Blackout, das mit hartem Beat, Synthie-Sounds und Keyboard im Hintergrund stark mit dem aggressiveren Ton von Benningtons Stimme harmoniert. Auch die Scratches, die mitten im Song auftauchen, passen irgendwie dazu, nur mit Shinodas ruhigem Part gegen Ende verliert der Song merklich an Power. Aber auch unter den wirklichen Songs gibt es klare Schwächen. Akustik-Nummer The Messenger ist der Oberlangweiler des Albums, passt musikalisch nicht im Geringsten zum Elektronik-beladenen Rest und wird auch von Benningtons kernigem Gesang nicht gerade gepusht. Dazu das viel zu brave Herumgedudel in Robot Boy und ein Reggae-Rhythmus in Waiting For The End, der im Kontext der Platte reichlich skurril wirkt, aber dennoch den fruchtbarsten Nährboden bietet. Mit dem direkten Einstieg "This is not the end / This is not the beginning / Just a voice like a riot / Rocking every revision" ist man sofort im Song drin. Alles in Allem ist das aber für eine gestandene Rockband zu wenig.
Wenn man schon mal bis zum dritten Track warten muss, um sich absolut sicher zu sein, dass man hier denn auch wirklich dem Interpreten lauscht, für den man sein hart erarbeitetes Geld verschwendet hat, heißt das schon was. Linkin Park versuchen mit A Thousand Suns ein Werk für die Ewigkeit zu schaffen und kreieren etwa 5-10 annehmbare Minuten. Der Rest ist ein überambitionierter und riskanter Versuch, der mächtig schiefgegangen ist. Brad Delsons Gitarre für die kalten Elektronik-Sounds zu opfern war keine gute Idee. Die apokalyptische Stimmung, die sich thematisch durch das Album zieht, kommt musikalisch kaum durch. Dafür bekommt man viel Stückwerk und wenig fertige Musik.
Jede sich selbst als authentische Musiker bezeichnende Gruppe sollte wissen, wo ihre Grenze liegt. So bremsen sich Shinoda und Co. nicht erst knapp vor der Klippe ein, sondern rasen mit Schallgeschwindigkeit in eine tiefe Schlucht. Und so bleibt man einerseits mit dem nüchternen Fazit, eines der schwächsten Alben eines renommierten Acts der letzten Jahre gehört zu haben, und andererseits mit der Herkulesaufgabe, zwei ganze Tracks für die Anspieltipps auswählen zu müssen, zurück. Verdient hätte es sich wohl keiner so richtig.
